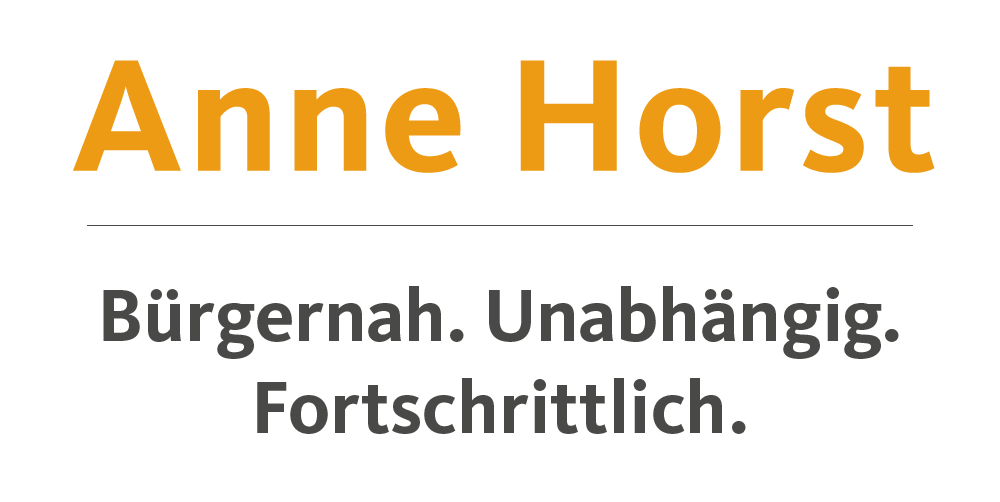Als Schirmherrin der Jubiläumsveranstaltung war ich gebeten worden, in meiner Rede die Geschichte von Lommersum aufzugreifen. Nur Jahreszahlen im Zeitablauf, das entsprach nicht meinen Vorstellungen. Deshalb habe ich die Rede mit vielen Bezügen zu unserer heutigen Zeit, mit dem Krimi “Mord auf Burg Derkum” und Beispielen, wie die Lebensmittelrationen aus den Hungerzeiten der beiden Weltkriege, gespickt. Lesen Sie selber!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lommersumerinnen und Lommersumer,
zur 975-Jahr-Feier unseres schönen Dorfes Lommersum, auch „Klein-Spanien“ genannt, begrüße ich Sie alle von Herzen.
Die Dorfvereinsgemeinschaft hat mich gebeten, in meiner Rede die Geschichte zum Dorf aufzugreifen. Also, ziehen wir durch die Zeit und erfahren,
wo der erste westdeutsche Campingplatz entdeckt wurde,
wann der Fußball in unser Dorf kam,
wer und was unsere Wurzeln sind,
was aus der Vergangenheit bewahrt und erhalten geblieben ist,
was teilweise noch heute unsere Traditionen und unseren Alltag prägt.
Beginnen wir mit dem Grund für unsere 975-Jahr-Feier.
Die erste urkundliche Erwähnung von Lommersum ist in einer Schenkungsurkunde von 1047 zu finden. Die Nonne Bezecha sagte sich von ihren irdischen Gütern los und schenkte Haus und Hof dem Kölner Stift St. Ursula. Beraten wurde sie von „Ihrem Rechtsbeistand Kristian von Lomundesheim“, heute Lommersum, der im Vertragstext erwähnt wird. Also wissen wir, vor 975 Jahren hieß unser schönes Dorf Lomundesheim.
Über die Jahre entwickelte sich der Name unseres Dorfes von Lomundesheim über Lomuntsheim (1173), Lomonsheim (1211), Lometzheim (1265), Lommitzheim (1316), Lomesheym (1387), Loymetzheim (1412), Lummelsheym (1488), L’hommersem (1581) bis Lommerschum (1587) Lommunsheim (1612) hin zu Lommserum.
Kommen wir zurück zum Jahr 975. Natürlich war Kristian von Lomundesheim nicht der erste Mensch, der im heutigen Lommersum lebte.
Fangen wir ganz von vorne an – nicht bei Adam und Eva, auch wenn für einige von uns Lommersum das Paradies ist, sondern in der Jungsteinzeit vor 10.000 Jahren, mit dem Ende der jüngsten Eiszeit, als es noch keine Dörfer gab, hier aber sehr wohl die „Eiszeitmenschen“ lebten. Knochenfunde belegen, dass sich unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren hier in Lommersum mit einer Rentierfarm versuchten.
Mit dem Klimawandel kam die Veränderung von Fauna und Flora, kam die Umstellung vom Jäger und Sammler zum Ackerbau treibenden Dorfbewohner. Das belegen europaweit bedeutsame Funde zum ersten westdeutschen Freilandwohnplatz, heute Campingplatz genannt, und die Reste eines Dorfes nahe der „Sieben Wege“.
Und damit hielt der Ackerbau Einzug in unser Lommersum, der bis heute die Umgebung unseres Dorfes prägt. Doch anders als heute gab es keine Erfahrungen und Beratungen zum Getreideanbau. Angepflanzt wurden Getreide wie Emmer, Dinkel, Einkorn und Gerste. Doch welche Getreidesorte nehme ich? Wann muss gesät werden? Wann geerntet? Auch lieferte keine Buir-Bliesheimer-Genossenschaft Saatgut, Pflanzenschutzmittel oder Dünger oder lagerte die Ernte. Wie die Ernte lagern, damit sie nicht verdarb? Spitzhacken, Steinbeile und Klingen waren die Werkzeuge der „Ur-Lommersumer“, mit denen die Ackerflächen bearbeitet und Getreide geerntet wurden. Unvorstellbar weit entfernt war man von dem heute üblichen Einsatz klimatisierter, PS-starker Schlepper und Landmaschinen, die heute sogar in der Lage sind, einen Strommast zu fällen und Industriebetriebe in 15 km Entfernung, wie die Raffinerie in Wesseling, stillzulegen. Damals war alles echte Handarbeit – “Learning by Doing” – hieß das Erfolgsrezept vor 10.000 Jahren.
Germanen, Römer und Franken lebten hier. Die erstmals erwähnte Kirche war um 837 eine Karolingische Saalkirche. Im Jahr 1987 feierte die Pfarrkirche St. Pankratius, Lommersum, das 1150-jährige Bestehen. Im 11. und 12. Jahrhundert gehörte Lommersum wie alle Ortsteile unserer Gemeinde Weilerswist zu den Aachener Pfalzgrafen. Und dann begann die Kleinstaaterei. Die Ortsteile der Gemeinde wurden aufgesplittert und drei verschiedenen Herrschaftsbereichen zugeordnet.
Ob diese Aufsplitterung quer durch die Gemeinde noch heute in den Köpfen einiger Kommunalpolitikerinnen oder -politiker verankert ist, kann ich nur vermuten.
1167 wurde Lommersum mit Kerpen dem Herzogtum Brabant zugeschlagen, 1430 zu Burgund, 1525 zu Spanien und 1712 zur Reichsgrafschaft Graf von Schaesberg. Diese wechselvolle Geschichte spiegelt sich noch heute in unseren Straßennahmen wider: Brabanter Straße und Brüsseler Straße, Kerpener und Limburger Straße, Walramstraße und Schaesbergasse. Neben den Emblemen der Lommersummer Landwirtschaft, Pflug und Schere, finden wir heute Turnierkragen, die Kugeln und das Hirschgeweih aus dem Wappen des Grafen Schaesberg in dem 1935 geschaffenen Gemeindewappen. Zeitzeugen der Geschichte sind unsere Kirche, das Spanische Rathaus und Gedenksteine auf dem alten Friedhof neben der Kirche. Unsere Grundschule wird nach dem Pfarrer Johannes Vincken benannt, der Anfang des 18. Jahrhunderts die erste Schule in Lommersum gründete.
Auch Traditionen aus dieser Zeit sind bis heute erhalten geblieben, die Kevelaer-Bruderschaft, gegründet 1731, und natürlich die Bezeichnung „Klein Spanien“. Und alle anwesenden Insider wissen, was nun kommt. Lommersum hat einen einmaligen und unverwechselbaren Ruf im Karneval. Und jetzt kommen Sie zum Einsatz: „Spanien – olé!“.
Treten wir kurz aus der geschichtlichen Zeitschiene heraus, hin zu einem Mysterium anno 1666.
Mord auf Burg Derkum! – Hieß es schon damals Nordeifel – Mordeifel?
Die Gerichtsakten aus dem Gemeindearchiv Weilerswist geben darüber einige Auskünfte und wurden von Peter Kraut in den Weilerswister Heimatblättern beschrieben. In der Burg Derkum lebten Jobsten Maximilian von der Leyd mit seiner Frau Christine Sybilla Magdalena von Vilstrop. Weiterhin wohnte auf der Burg der Knecht Michael Fröhlich aus Friesheim. Und Michael, das konnte er nicht verbergen, hatte sich in die Ehefrau seines Herrn verguckt.
Was geschah in jener Nacht, der Nacht zum 21. Februar 1666?
Stellen Sie sich vor, es war stockfinstere Nacht, nur der Halbmond schien. Michael Fröhlich schlich sich zu der Fallbrücke der Burg. Vorsichtig stieg er an der Mauer zum Burgweiher herab. Normalerweise stand hier alles unter Wasser. Doch der Burgweiher war kurz zuvor abgelassen worden. Entschlossen tastete er sich im Mondlicht über den schlüpfrigen Untergrund entlang der Mauer. Dort lag die bereitgestellte Leiter. Die lehnte er an die Hauswand, stieg hinauf und näherte sich seinem Ziel: einem Loch in der Mauer unterhalb des Fensters der Schlafkammer. Das Loch gab die Sicht in das dahinterliegende Zimmer frei. Dort befand sich der Burgherr von der Leyd – und seine Frau.
Vorsichtig zielte Michael durch das Loch und erschoss den Burgherrn mit drei Kugeln.
Nach der Tat stieg er die Leiter herab, schlidderte über den Grund des Burgweihers, erklomm die Mauer an der Fallbrücke der Burg und schlich sich zurück in seine Kammer. Alles war wie geplant verlaufen – oder doch nicht?
Denn kurze Zeit später standen der Schultheißen und die Schöffen des Gerichtes Lommersum, benachrichtigt von der Ehefrau des Ermordeten, vor seiner Tür. Michael Fröhlich war zu der Tatzeit der einzige anwesende Knecht auf dem Hof. Und bei seiner Befragung verstrickte sich der Knecht auch noch in Widersprüche. Da stand für das Lommersumer Gericht der Täter fest. Michael Fröhlich wurde zum Tode verurteilt. Doch das Bonner Hofgericht, das das Urteil bestätigen sollte, wollte mehr zu den Hintergründen der Tat erfahren. War es Liebe oder nur Mittel zum Zweck, wollte die Ehefrau nur ihren Mann loswerden? – All dies waren nur Vermutungen.
Eigenartig war, wie schnell der Mörder überführt wurde; bekamen die Schöffen einen Hinweis von der Witwe von der Leyd? Woher sollte der Knecht die Schusswaffe haben? Wie konnte er drei Kugeln abfeuern ohne das Risiko der Entdeckung, oder stand er auf der Leiter und hat die Waffe zweimal – bei Mondlicht – nachgeladen? Die Ehefrau befand sich im selben Zimmer, in dem der Mord geschah, und sie beugte sich nach eigener Aussage nur zur Seite? All das lässt vermuten, dass der Täter sich sehr sicher fühlte und im Einverständnis mit der Witwe den Mord begangen hatte. Im Auftrag des Bonner Hofgerichts wurde die peinliche Befragung durchgeführt. Unter Folter gestand der Knecht die Tat.
Letztlich wurden Tathergang, Motiv und insbesondere die Rolle der Ehefrau Christine Sybilla Magdalena von Vilstrop bei diesem Verbrechen nie wirklich geklärt. Doch Michael Fröhlich aus Friesheim wurde wegen „der Mordtat an seinem eigenen Herrn hingerichtet“. – Was geschah in der Nacht zum 21. Februar 1666? – Dieser Fall wird wohl nie geklärt werden und sich als Krimi in die Reihe Nordeifel – Mordeifel einfügen.
Zurück zur Zeitreise:
1794 marschierten die Franzosen in das linksrheinische Rheinland ein. Sie brachten uns eine einheitliche Verwaltungsorganisation und Gemeindeverfassung, die Neugliederung der Bistümer und Pfarreien, das französische Zivilrecht und Strafrecht. Und nachdem die Franzosen all diese, bis heute bedeutsamen Errungenschaften, etabliert hatten, kamen die Preußen ins Rheinland, Lommersum wurde 1815 Teil des Königreichs Preußen. Den Preußen verdanken wir ein systematisch angelegtes Straßen- und Schienennetz. Die Straße von Köln nach Trier wurde in der Zeit von 1824 bis 1830 gebaut, die Bahnstrecke Köln-Trier 1875. Mit den Preußen kamen auch die Paraden zu Ehren Kaiser Wilhelms I. und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal nach Lommersum. Errichtet wurde es vom Landwirtschaftlichen Casino Lommersum im Jahre 1887. 1842, 1877 und 1884 wurden große Paraden auf den Flächen zwischen Euskirchen und Lommersum abgehalten.
Während der Preußischen Zeit änderte sich mehrmals die Verwaltungszugehörigkeit des Bürgermeisteramtes Lommersum: Kreis Lechenich, Kreis Euskirchen, dann ab 1868 Amt Weilerswist-Lommersum bis zur kommunalen Neugliederung am 01.07.1969 mit der Großgemeinde Weilerswist, Kreis Euskirchen.
Gehen wir mit unserer Zeitreise in den Beginn des 20. Jahrhunderts, Jahre des wirtschaftlichen Aufstiegs, die Wohlstand auch nach Lommersum brachte. Überschattet wurde diese Entwicklung von Konflikten zwischen den Staaten Europas bis hin zu einer gewaltsamen Entladung, dem Ersten Weltkrieg.
Und damit brach eine lange, dunkle Epoche für Deutschland und damit auch für Lommersum an. Die Männer wurden mit der Mobilmachung aus ihren Familien gerissen. Insgesamt fielen 63 Soldaten aus Lommersum im ersten Weltkrieg. Hunger und Mangelverwaltung, – (Korb mit Inhalt) Im Oktober 1917 wurden als Tagesration 200 g Mehl oder wöchentlich 3 ¾ Pfund Brot, sowie 7 Pfund Kartoffeln und 250 bis 300 g Fleisch pro Woche festgelegt. -, der Wechsel von Monarchie zur Republik, frierende und hungernde Menschen, Inflation, hohe Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg an die Kriegsgewinner und Arbeitslosigkeit prägten die Entwicklung.
Aber ein Highlight gab es doch: ein neues Ballspiel, das die englischen Besatzer mit nach Lommersum brachten: Fußball hielt Einzug in Lommersum – und ist bis heute eine Leidenschaft vieler Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner.
Diese Gemengelage nutzte die NSDAP skrupellos für ihre Propaganda. Mit Erfolg: Am 30. Januar 1933 ergriff Hitler die Macht, mit der tiefgreifende Änderungen auf allen Gebieten des staatsbürgerlichen Lebens einhergingen hin zu einem menschenverachtenden Staatssystem. Menschen, die laut der nationalsozialistischen Ideologie nicht zu dem deutschen Herrenvolk und der „arischen Rasse“ gehörten, wurden auch in Lommersum verachtet, verfolgt, verschleppt, liquidiert. Unter dem herrschenden Druck wanderten die jüdischen Familien Simon und Geschwister Stock aus, während Wilhelm Kain und Hermann Stock mit ihren Angehörigen in Sammellager abtransportiert wurden.
Auch die Wehrmacht schätzte die Lommersumer Flur als Areal für Aufmärsche und hielt dort am 16. September 1937 eine Parade ab. Ein Tag, der Lommersum weit über seine Grenzen hinaus bekannt machte. Für ungefähr 10.000 Zuschauer wurden hölzerne Tribünen errichtet. Während der Parade brach eine der Tribünen zusammen. Zu schnell und ohne Sorgfalt waren sie gebaut worden. Die Menschen wurden heruntergerissen und unter Tribünenteilen und anderen Zuschauern begraben. Es gab ein heilloses Chaos. Die Menschen wurden vor Ort von herbeigeholten Ärzten versorgt oder in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Insgesamt gab es 800 Verletzte und wundersamer Weise keine Todesopfer.
Im Zweiten Weltkrieg verloren insgesamt 72 Soldaten aus Lommersum ihr Leben, 32 galten als vermisst. – Noch heute erinnert das Ehrenmal in Nachbarschaft zur Kirche und zum Spanischen Rathaus an die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Man muss sich das Leben in Lommersum zu der damaligen Zeit einmal vorstellen:
Erst der Krieg, in dem Familienmitglieder und Freunde auseinandergerissen und getötet wurden, dann zwei schwere Hochwasser in 1940 und 1942, in denen Gärten und Häuser im Hinterdorf einen Meter unter Wasser standen, ein langer, eiskalter Winter, dann die gefährlichen Hinterlassenschaften der abziehenden Truppen, die zwei Kinder beim Spiel schwer verletzten und eines töteten und der quälende der Hunger, (Korb: je Woche: 500 g Brot, 50 g Fleisch, 62 g Fett, 50 g Nährmittel und 1000 g Kartoffeln), Und trotzdem haben sich die Lommersumer genauso wenig unterkriegen lassen, wie die Menschen im übrigen Deutschland. Unverdrossen packten sie an, beseitigten die Spuren des Krieges und begannen mit dem Wiederaufbau.
Als ich das las, konnte ich einige Parallelen zum heutigen Leben in Lommersum entdecken: schweres Hochwasser, die Angst vor einem Krieg mit Russland, Inflation, Energiemangellage. Doch im Vergleich auf einem ganz anderen Niveau. Deshalb sollten wir mit derselben Einstellung die aktuelle Krise meistern, zusammenstehen und uns gegenseitig stützen.
Doch zurück zu unserer Zeitreise:
In den Folgejahren nach dem Krieg wurden die Infrastruktur, Brücken, Eisenbahn, Straßen und Abwasserkanäle gebaut. Die „Fichtel“, der Gemeindewald, entstand 1950 neu. Das Dorf Lommersum hat sich bis heute zu einem Dorf mit umfangreicher und moderner Infrastruktur entwickelt. Neubaugebiete an den Ortsrändern haben das Dorf wachsen lassen. Allerdings ist auch erkennbar, dass die früher das Ortsbild prägende Landwirtschaft, das Handwerk und der Einzelhandel stark an Bedeutung verloren haben.
Und nun komme ich zum Schluss unserer Zeitreise.
Die wechselvolle Geschichte unseres Dorfes zeigt,
viele sind gekommen, viele sind gegangen, einige sind geblieben.
Sie haben Spuren in unserer Gesellschaft, unserer Infrastruktur und unserem Miteinander hinterlassen – bis heute.
Diese Wurzeln und alle die, die Lommersum heute als Wohn- und Arbeitsort für sich wählen, machen uns zu dem, was wir heute sind:
eine engagierte Dorfgemeinschaft, die nicht nur Feste feiert, wie sie fallen, sondern auch in Krisensituationen – wie letztes Jahr bei dem katastrophalen Hochwasser – zusammensteht und die Zukunft des Dorfes in die Hand nimmt, wie das LEADER-Projekt des SSV Lommersum für ein gesellschaftliches Miteinander und der Wunsch der Dorfgemeinschaft zur Neugestaltung des Kaiser-Wilhelm-Platzes zeigt.
In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch Lommersum und allen die hier leben!
Bild: Ulrich Horst